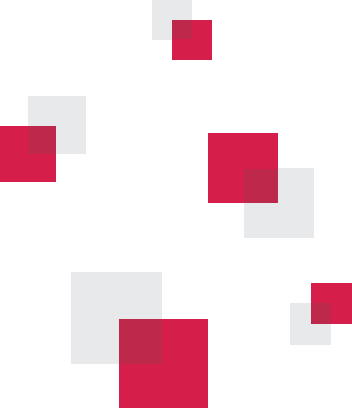Die Coronapandemie hat die Digitalisierung beim Bund beschleunigt. Wo stehen wir heute?
Anne Lévy: Die Coronapandemie war ein Weckruf. Die Frage ist heute nicht mehr, ob die Schweiz ihr Gesundheitswesen digitalisieren soll, sondern, wie schnell und wie gut uns das gelingt. Auch das BAG hat seither viel gemacht. Ich denke da beispielsweise an das «Radiation Portal Switzerland». Hier können Spitäler oder Arztpraxen ihre Röntgengeräte digital registrieren, Bewilligungen einholen oder Gesuche einreichen. Auch bei den Meldungen von übertragbaren Krankheiten hat sich einiges getan. Heute melden uns beispielsweise die Labore Grippeerkrankungen ausschliesslich digital. Diesen digitalen Meldeprozess weiten wir nun schrittweise auf andere meldepflichtige Erreger aus.
Wo liegt der Nutzen für die Bevölkerung?
Ein Teil der Daten fliesst direkt ins öffentliche Infoportal übertragbare Krankheiten. So lässt sich zum Beispiel die Entwicklung der Fallzahlen bei Grippe, dem RS-Virus oder der Frühsommer-Meningo-Enzephalitis (FSME) direkt nachverfolgen. Ein solches Frühwarnsystem hilft der Ärzteschaft bei der Planung und der Bevölkerung etwa beim Impfentscheid.
Anfang 2025 hat das BAG das nationale Programm DigiSanté lanciert. Was bezweckt es?
DigiSanté will die digitale Transformation im Schweizer Gesundheitswesen vorantreiben. Im Zentrum steht ein digitaler Service public, bei dem Gesundheitsdaten nur einmal erfasst, sicher ausgetauscht und mehrfach genutzt werden können. Heute setzen Arztpraxen, Spitäler, Labore und Apotheken auf relativ isolierte IT-Systeme. Damit Daten ausgetauscht werden können, müssen die IT-Systeme dieselbe Sprache sprechen.
«Damit Daten ausgetauscht werden können, müssen die IT-Systeme dieselbe Sprache sprechen»
Können Sie ein Beispiel geben?
Technisch kann es daran scheitern, dass die verschiedenen Systeme nicht miteinander verbunden werden können. Und wenn die Verbindung klappt, kann der Datenaustausch trotzdem nicht funktionieren. Dies, weil beispielsweise Daten unterschiedlich dargestellt werden und deshalb nicht eindeutig gelesen werden können. Oder wenn das weibliche Geschlecht einmal mit «f», einmal mit «w» und ein anderes Mal mit «1» angegeben wird, kann dies ebenfalls zu Missverständnissen führen. Was es also braucht, sind einheitliche Regeln, wie Daten ausgetauscht, strukturiert und verstanden werden müssen. Nur so gelingt eine sichere und reibungslose Kommunikation zwischen unterschiedlichen Systemen.
Wer soll für solche Standards im Gesundheitswesen sorgen?
Damit diese Standards praxistauglich sind und breite Akzeptanz finden, müssen sie gemeinsam mit den Anwenderinnen und Anwendern entwickelt werden und sich an etablierten, internationalen Datenstandards orientieren. Dabei möchte ich betonen: Der Bund baut keine neuen Praxis- oder Klinik-Informationssysteme, er stellt jedoch Teile der Infrastruktur und nationale Dienste wie zum Beispiel zentrale Verzeichnisse bereit. Damit werden sichere und nahtlose Datenflüsse zwischen den verschiedenen Systemen möglich. Zudem digitalisiert der Bund seine eigenen Behördenleistungen und stimmt sie auf die zahlreichen Digitalisierungsprojekte von DigiSanté ab.
Wie werden sensible Gesundheitsdaten geschützt?
Datenschutz, IT- und Cybersicherheit sind bei DigiSanté zentral – etwa beim Transfer, bei der Bearbeitung und der Speicherung von Daten. Diese Sicherheitsvorgaben müssen in jedem Fall eingehalten und mögliche Risiken minimiert werden.
Sind dafür Gesetzesänderungen nötig?
Nein, die bestehenden Datenschutzgesetze von Bund und Kantonen sind ausreichend. Wichtig ist, dass sie eingehalten werden.
Die Forschung wünscht sich einen besseren Zugang zu Gesundheitsdaten. Inwiefern schafft DigiSanté hier Abhilfe?
In der medizinischen Behandlung, zur Diagnose, zur Therapie oder zur Abrechnung fallen zahlreiche Gesundheitsdaten an. DigiSanté sorgt mit verbindlichen Datenstandards dafür, dass diese Daten nahtlos und sicher fliessen können. Darüber hinaus wären diese Daten aber auch für die Forschung oder zur Planung und Steuerung des Gesundheitswesens nützlich. Hier sprechen wir dann von einer Sekundärnutzung der Daten. So können beispielsweise Daten aus Spitälern dabei helfen, herauszufinden, wie häufig bestimmte Krankheiten auftreten oder wie gut Behandlungen wirken.
Erhält damit auch die Pharmabranche Zugang zu den Gesundheitsdaten?
Grundsätzlich ja. Der Zugang zu den Gesundheitsdaten muss jedoch für jedes Forschungsprojekt einzeln beantragt werden. Der Zugriff beschränkt sich dabei auf die für das Projekt notwendigen Daten. Diese werden vorher anonymisiert, sodass sie keine persönlichen Informationen wie Name oder Adresse enthalten. Und sie werden zu grossen Mengen zusammengeführt, sodass nur das grosse Ganze sichtbar ist. Und zu guter Letzt werden die Daten nur dann für die Sekundärnutzung verwendet, wenn man dem zugestimmt hat.
Was kostet DigiSanté?
Das Parlament hat 2024 aus Bundesmitteln einen Verpflichtungskredit von rund 400 Millionen Franken für zehn Jahre gesprochen.
Ist DigiSanté auch von den Sparmassnahmen betroffen, die das BAG im Februar angekündigt hat?
Wir mussten Ressourcen innerhalb des BAG umverteilen. Und zwar so, dass wir Arbeiten und Grundleistungen für strategisch wichtige Bereiche wie beispielsweise die Digitalisierung weiter ermöglichen können. Das hat dann in anderen Bereichen leider zu Kürzungen geführt. Die Digitalisierung ist eine Investition in die Zukunft. Es wird in jeder Budgetdebatte des Parlaments eine Herausforderung sein, dafür die nötigen Mittel aus einem sehr angespannten Bundeshaushalt zu erhalten.
«Dänemark gilt international als Vorreiter»
Gibt es für DigiSanté internationale Vorbilder?
Wir stehen mit anderen europäischen Ländern in engem Austausch, wie Dänemark oder Österreich, bei denen die Digitalisierung des Gesundheitswesens bereits weiter fortgeschritten ist. Gerade Dänemark gilt international als Vorreiter mit seiner elektronischen ID und seinem elektronischen Patientendossier, das als Teil eines nationalen Gesundheitsportals fungiert. Im Gegensatz zu Dänemark ist in der föderalen Schweiz das Gesundheitswesen stark fragmentiert. Das macht es komplexer. Für uns bedeutet das, dass wir gemeinsam mit allen Akteuren tragfähige Lösungen finden und umsetzen müssen.
Ist das elektronische Patientendossier (EPD) Teil von DigiSanté?
Das elektronische Patientendossier wurde bereits vor dem Start von DigiSanté so weit entwickelt, wie dies der Gesetzgeber damals vorgesehen hat: Es ist da, kann schweizweit eröffnet werden und wird auch laufend weiterentwickelt. DigiSanté schafft – losgelöst vom elektronischen Patientendossier – jetzt die Voraussetzungen für die Digitalisierung des gesamten Gesundheitssystems, zu dem auch das EPD gehört.
Können Sie ein Beispiel für dessen Nutzen machen?
Stellen wir uns eine Frau aus Genf vor. Sie ist im Wallis in den Ferien und bricht sich bei einem unglücklichen Sturz das Handgelenk. Im Spital Sitten werden Röntgenaufnahmen gemacht, sie wird notfallmässig operiert und nach ein paar Tagen aus dem Spital entlassen. Beim Austritt aus dem Spital bekommt sie Medikamente verschrieben, und es gibt einen umfassenden Austrittsbericht. Sind all diese Unterlagen nun im elektronischen Patientendossier der Frau abgelegt, kann ihr Hausarzt diese vor dem nächsten Termin einsehen – ohne dass er dafür noch einen Extraaufwand betreiben muss. Das entlastet, spart Zeit, vermeidet Fehler und verbessert die Behandlung.
Wie gross ist die Bereitschaft der Akteure zur Zusammenarbeit bei DigiSanté?
Erfreulich gross. Die Einsicht ist da, dass etwas gehen muss und dass wir damit auch nicht mehr lange warten können. Eindrücklich finde ich beispielsweise die Zusammenarbeit in der Fachgruppe Datenmanagement. Diese hat bereits Ende 2022 ihre Arbeit aufgenommen – also vor dem offiziellen Start von DigiSanté in diesem Jahr. Vertreten sind hier Expertinnen und Experten von Bund, Kantonen, Spitälern, Ärzte- und Apothekerschaft, von Krankenversicherungen, der forschenden Pharmaindustrie sowie weitere Akteure des Gesundheitswesens. Gemeinsam identifizieren sie Handlungsfelder und erarbeiten konkrete Lösungen.
Zum Schluss: Wo stehen wir in zehn Jahren?
In zehn Jahren ist der digitale Umgang mit Gesundheitsdaten so selbstverständlich wie heute das Onlinebanking. Wir zeigen in der Apotheke ein digitales Rezept, der Hausarzt hat Zugriff auf unsere Spitaldokumente, und meine Gynäkologin sieht, welche Medikamente mir verschrieben wurden. Zudem werden Gesundheitsfachpersonen nicht mehr Hunderte von Klicks benötigen, um unsere Informationen zu managen, sondern sie können sich auf den automatisierten Datenaustausch zwischen Computern verlassen. Etwas wird sich aber auch in zehn Jahren nicht geändert haben: Im Zentrum eines guten Gesundheitswesens stehen Menschen. Digitalisierung soll und kann die Gesundheitsfachpersonen unterstützen. Damit sie weniger Zeit am Computer verbringen müssen und mehr Zeit für die Behandlung haben.
Das Interview wurde schriftlich geführt.
DigiSanté wurde im Auftrag des Bundesrats vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) gemeinsam mit dem Bundesamt für Statistik (BFS) erarbeitet und läuft über zehn Jahre. Mehr Informationen unter digisante.ch.
Anne Lévy
Anne Lévy ist seit Herbst 2020 Direktorin des Bundesamts für Gesundheit (BAG). Zuvor leitete die 54-jährige Politologin die Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel. Davor war sie im Kanton Basel-Stadt für den Gesundheitsschutz verantwortlich.