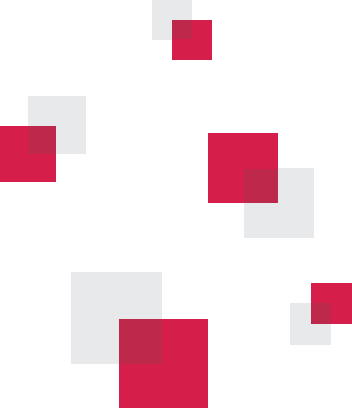Auf einen Blick
- Die Zahl der Personen ab 65 Jahren wird in den kommenden Jahren deutlich zunehmen, was zu einem höheren Bedarf an Unterstützungsleistungen führen wird.
- Positive Entwicklungen beim Bildungsniveau, bei der sozialen Unterstützung und den funktionellen Einschränkungen könnten den wachsenden Unterstützungsbedarf etwas abschwächen.
- Die Auswirkungen der Digitalisierung und der Individualisierung der Gesellschaft auf den Unterstützungsbedarf älterer Menschen können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschliessend beurteilt werden.
Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) richtet gestützt auf Artikel 101bis des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) Finanzhilfen an private, als gemeinnützig anerkannte und gesamtschweizerisch tätige Altersorganisationen aus. Nach der kürzlichen Revision der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) wurde das BSV beauftragt, die Grundlagen zu erarbeiten, damit der Bundesrat den Höchstbetrag dieser Finanzhilfen festlegen kann. Dabei sollte er sich insbesondere auf die Bedarfsentwicklung stützen.
Vor diesem Hintergrund erhielt das Büro BASS den Auftrag, die Entwicklung des Bedarfs an Leistungen der Altershilfe zu untersuchen (Gajta et al. 2025). Um einen Überblick über die Einflussfaktoren zu erstellen, stützte sich das Projektteam auf die wissenschaftliche Literatur sowie die Unterlagen der subventionierten Organisationen und führte Interviews mit Fachpersonen durch. Anschliessend wurden die ermittelten Einflussfaktoren empirisch analysiert: Zum einen wurde die Entwicklung zwischen 2012 und 2022 und zum anderen das Verhältnis zwischen den festgestellten Entwicklungen und der Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen sowie dem Unterstützungsbedarf untersucht. Dazu wurden die Daten der Schweizerischen Gesundheitsbefragung (SGB) herangezogen.
Die Altershilfe wird als Gesamtheit aller unterstützenden, stärkenden und fördernden Massnahmen definiert, die ältere Menschen dazu befähigen, so lange wie möglich zu Hause zu leben und ein aktives und selbstbestimmtes Leben zu führen (Stettler et al. 2020). Bei den Finanzhilfen ist zudem ein besonderes Augenmerk auf vulnerable Gruppen zu richten. Als vulnerabel gelten Personen, die eine Kumulation von ökonomischer, sozialer, kultureller und körperlicher Benachteiligung erleben (Gasser et al. 2015).
Demografische Alterung und Migration
Die Analyse förderte zunächst mehrere allgemeine Faktoren zutage, die den Unterstützungsbedarf und die Inanspruchnahme von Leistungen der Altershilfe beeinflussen. Sie widerspiegeln die langfristigen gesellschaftlichen Entwicklungen und lassen sich in vier Hauptkategorien unterteilen: demografische, gesundheitsspezifische, gesellschaftliche Entwicklungen sowie intervenierende Faktoren.
Zu den demografischen Entwicklungen zählen insbesondere die demografische Alterung und die Migration. In der Schweiz nimmt der Anteil der Bevölkerung ab 65 Jahren aufgrund der niedrigen Geburtenrate und der steigenden Lebenserwartung stark zu. Prognosen zufolge wird ihre Zahl von 1,64 Millionen im Jahr 2020 (18,9% der Bevölkerung) auf 2,09 Millionen im Jahr 2030 (22,1%) ansteigen. Obwohl das Alter allein nicht den Unterstützungsbedarf bestimmt, erhöht sich dieser mit zunehmendem Alter, was auch die Nachfrage und die Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen ansteigen lassen dürfte.
Auch die Migration ist ein potenziell wichtiger demografischer Einflussfaktor. In den kommenden Jahren dürfte der Anteil der Personen mit Migrationshintergrund an der Bevölkerung ab 65 Jahren zunehmen (BFS 2020). Diese Bevölkerungsgruppe könnte theoretisch einen anderen Unterstützungsbedarf aufweisen und andere Leistungen in Anspruch nehmen als die Bevölkerung ohne Migrationshintergrund.
Höhere Lebenserwartung
Die gesundheitsspezifischen Entwicklungen sind ebenfalls entscheidend, um die Veränderungen im Unterstützungsbedarf zu erfassen. Die Lebenserwartung ab 65 Jahren steigt kontinuierlich an, wohingegen die Häufigkeit von funktionellen Beeinträchtigungen eher zurückgeht. Folglich bleiben mehr Jahre ohne funktionelle Beeinträchtigungen, während die Lebenszeit mit Beeinträchtigungen relativ stabil bleibt oder sogar abnimmt (Seematter-Bagnoud et al. 2021). Der Zeitraum, in dem ältere Menschen Unterstützung benötigen, bleibt somit tendenziell gleich lang.
Auch andere gesundheitsspezifische Faktoren können den Unterstützungsbedarf beeinflussen, wobei gegenläufige Trends zu beobachten sind: Während sich das Gesundheitsverhalten (Tabak- und Alkoholkonsum, Übergewicht, körperliche Aktivität) und der selbst wahrgenommene Gesundheitszustand eher positiv entwickeln, nimmt der Anteil älterer Menschen mit chronischen Gesundheitsproblemen, Multimorbidität oder psychischen Störungen tendenziell zu (BFS 2012, 2017, 2022).
Bildungsniveau steigt
Zu den wichtigsten gesellschaftlichen Entwicklungen gehört das Bildungsniveau der älteren Menschen, das sich auf ihren Unterstützungsbedarf und ihren Zugang zu Unterstützungsleistungen auswirkt. Ein hohes Bildungsniveau verbessert die finanzielle Situation, die Gesundheit und die Kenntnisse über das Leistungsangebot. Ein niedriges Bildungsniveau erhöht hingegen den Unterstützungsbedarf, schränkt aber zugleich die Inanspruchnahme ein. In der Schweiz nimmt das durchschnittliche Bildungsniveau älterer Menschen zu, wobei der Anteil der Personen mit einem Abschluss auf Tertiärstufe von 16,8 Prozent (2010) auf 26,5 Prozent (2022) angestiegen ist.
Eine weitere zentrale gesellschaftliche Entwicklung mit widersprüchlichen Auswirkungen ist die Digitalisierung. Bei Menschen, die mit dem technologischen Fortschritt zurechtkommen, kann dieser bestimmte Einschränkungen ausgleichen. Die vulnerabelsten unter ihnen können jedoch aufgrund der zusätzlichen Hindernisse der Digitalisierung ausgeschlossen werden. Andere signifikante gesellschaftliche Entwicklungen sind beispielsweise die steigende Zahl der älteren Menschen, die alleine zu Hause leben, die zunehmende Mobilität und die geografische Entfernung zur Familie oder auch eine veränderte Einstellung der älteren Menschen zu Unterstützungsleistungen. Das Verhältnis zwischen diesen Entwicklungen und dem Unterstützungsbedarf sowie der Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen ist in der Schweiz jedoch noch wenig dokumentiert.
Hinzu kommen intervenierende Faktoren, die sich in verschiedener Hinsicht auf die Altershilfe auswirken. Dazu gehören beispielsweise der Klimawandel, Massnahmen der Prävention und Gesundheitsförderung, eine veränderte Wahrnehmung des Älterwerdens sowie Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt, insbesondere der Personalmangel im Gesundheits- und Sozialwesen und die stärkere Erwerbsbeteiligung der Frauen. Es bleibt jedoch unklar, welchen Einfluss diese Faktoren haben und wie sie sich entwickeln werden.
Individuelle Faktoren massgebend
Neben den allgemeinen Faktoren gibt es auch eine Reihe von individuellen Einflussfaktoren. Obwohl die allgemeinen Faktoren die individuellen Faktoren beeinflussen, bleiben letztere für den Unterstützungsbedarf und die Inanspruchnahme von Leistungen ausschlaggebend. Die individuellen Faktoren können in drei Kategorien eingeteilt werden: Einschränkungen und Ressourcen, sozioökonomische Aspekte und Umfeld.
Zu den Einschränkungen und Ressourcen zählen die individuellen geistigen und körperlichen Fähigkeiten. Die funktionellen Einschränkungen beziehen sich auf die Schwierigkeit einer Person, bestimmte grundlegende Aktivitäten durchzuführen, bei denen sie möglicherweise auf Hilfe angewiesen ist. Sowohl die funktionellen Einschränkungen in den instrumentellen Alltagsaktivitäten (IADL) als auch die funktionellen Einschränkungen bei grundlegenden Alltagsaktivitäten (ADL) haben im Laufe der Zeit tendenziell abgenommen, was einen geringeren Unterstützungsbedarf vermuten lässt.
Ältere Menschen können diese Einschränkungen teilweise durch ihre psychosozialen Ressourcen ausgleichen. Die psychosozialen Ressourcen gehen in der Regel mit einem besseren selbst wahrgenommenen Gesundheitszustand, weniger depressiven Symptomen und einer geringeren Sterblichkeit einher und können daher als Schutzfaktoren angesehen werden. Gemäss jüngsten Entwicklungen gehen die psychosozialen Ressourcen eher zurück, was den Unterstützungsbedarf erhöhen dürfte.
Eine wesentliche Rolle spielen auch sozioökonomische Aspekte. Der Einfluss der individuellen finanziellen Situation auf den Unterstützungsbedarf und die Inanspruchnahme von Leistungen ist ambivalent. Zum einen geht eine bessere finanzielle Situation in der Regel mit einem besseren Gesundheitszustand sowie mehr psychosozialen Ressourcen und folglich einem geringeren Unterstützungsbedarf einher. Zum anderen kann eine prekärere finanzielle Situation zwar mit einem höheren Unterstützungsbedarf verbunden sein, aufgrund von Hürden bei der Finanzierung oder beim Zugang zu den Leistungen aber dazu führen, dass diese nicht in Anspruch genommen werden. In Bezug auf die Entwicklung der finanziellen Situation im Alter zeigt sich, dass der Anteil der armutsbetroffenen oder -gefährdeten älteren Menschen sowie der Anteil der älteren Menschen, die Ergänzungsleistungen (EL) beziehen, stabil bleiben.
Ein weiterer zentraler Aspekt ist die soziale Unterstützung, auf die eine Person zurückgreifen kann: je grösser die soziale Unterstützung, desto geringer der Unterstützungsbedarf und die Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen. Neueren Trends zufolge steigt der Anteil älterer Menschen, die sich einsam fühlen, nicht zuletzt aufgrund der Individualisierung der Gesellschaft und der grösseren geografischen Entfernung zur Familie. Gleichzeitig deuten andere Entwicklungen darauf hin, dass ältere Menschen ihr soziales Netzwerk erweitern, indem sie häufiger Kontakt mit Personen ausserhalb der Familie pflegen.
Schliesslich kann auch das individuelle Umfeld, in dem ältere Menschen leben, den Unterstützungsbedarf und die Inanspruchnahme von Leistungen beeinflussen. Erwähnenswert sind nebst dem bereits genannten familiären und sozialen Umfeld auch das Wohnumfeld und die Qualität des Zuhauses sowie der Zugang zu Leistungsangeboten. So sorgt beispielsweise die Bevölkerungsdichte in städtischen Zentren dafür, dass verschiedene Dienstleistungen besser erreichbar sind, sie steigert aber auch die gesundheitlichen Belastungen. Darüber hinaus wird sich die Strategie «ambulant vor stationär» zweifellos auf den langfristigen Bedarf an Unterstützung zu Hause auswirken.
Ambivalente Entwicklungen
Einige der erwähnten Faktoren wurden anschliessend in einer empirischen Analyse untersucht, namentlich das Alter, die funktionellen Einschränkungen bei instrumentellen Alltagsaktivitäten, die psychosozialen Ressourcen, das Bildungsniveau, die soziale Unterstützung und die finanzielle Situation. Diese Faktoren decken alle vier Vulnerabilitätsdimensionen ab: das körperliche, das kulturelle, das soziale und das wirtschaftliche Kapital (Gasser et al. 2015).
Die univariaten und multivariaten Analysen, die auf den Mikrodaten der Schweizerischen Gesundheitsbefragung beruhen, verdeutlichen die Bedeutung der verschiedenen Indikatoren, die zur Vorhersage des künftigen Unterstützungsbedarfs und der Inanspruchnahme von Leistungen ausgewählt wurden. Besonders relevant sind in dieser Hinsicht das Alter, die Einschränkungen und die psychosozialen Ressourcen. Während das Alter und die Einschränkungen positiv mit der Inanspruchnahme von Leistungen korrelieren, haben andere Faktoren (psychosoziale Ressourcen, soziale Unterstützung, finanzielle Situation, Bildungsniveau) einen gegenteiligen Effekt.
Anhand der festgestellten Entwicklungen dieser Faktoren lassen sich Hypothesen zu den subventionierten Leistungen ableiten. Da das Alter der wichtigste Faktor ist und sich die Zahl der Menschen ab 65 Jahren in Zukunft erhöhen wird, ist mit einem steigenden Leistungsvolumen zu rechnen. Die erwartete Zunahme der sozialen Unterstützung, das gestiegene Bildungsniveau und die tendenziell geringeren Einschränkungen könnten jedoch dazu führen, dass bestimmte Dienstleistungen wie Besuchs- oder Fahrdienste verhältnismässig weniger in Anspruch genommen werden. Demgegenüber könnten Beratungs-, Informations- und Orientierungsangebote aufgrund der tendenziell abnehmenden psychosozialen Ressourcen vermehrt genutzt werden. Die finanzielle Situation dürfte relativ stabil bleiben.
Obwohl die Hypothesen unsicher sind, beleuchten sie die wahrscheinliche Entwicklung des Unterstützungsbedarfs älterer Menschen in der Schweiz und die Auswirkungen auf die Unterstützungsleistungen. Für eine Validierung bräuchte es umfassendere Daten zu den Leistungsempfängerinnen und -empfängern. Dennoch zeigen die Ergebnisse, wie wichtig es ist, die künftigen Herausforderungen in der Altershilfe bereits jetzt anzugehen.
Literaturverzeichnis
BFS (2012, 2017, 2022). Schweizerische Gesundheitsbefragung (SGB).
BFS (2020). Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung der Schweiz und der Kantone 2020–2050.
Gajta, Patrik; Zuchuat, Jeremy; Stettler, Peter; Heusser, Caroline (2025). Entwicklung des Bedarfs an Leistungen der Altershilfe gestützt auf Art. 101bis AHVG; Studie im Auftrag des BSV. Beiträge zur Sozialen Sicherheit. Forschungsbericht Nr. 4/25
Gasser, Nadja; Knöpfel, Carlo; Seifert, Kurt (2015). Erst agil, dann fragil: Übergang vom «dritten» zum «vierten» Lebensalter bei vulnerablen Menschen. Pro Senectute Schweiz.
Seematter-Bagnoud, Laurence; Belloni, Giulia; Zufferey, Jonathan; Peytremann-Bridevaux, Isabelle; Büla, Christophe; Pellegrini, Sonia (2021). Lebenserwartung und Gesundheitszustand: jüngste Entwicklungen (Obsan Bulletin 03/2021). Schweizerisches Gesundheitsobservatorium.
Stettler, Peter; Egger, Theres; Heusser, Caroline; Liechti, Lena (2020). Ausgestaltung der Altershilfe in den Kantonen. Studie im Auftrag des BSV. Forschungsbericht Nr. 3/20.