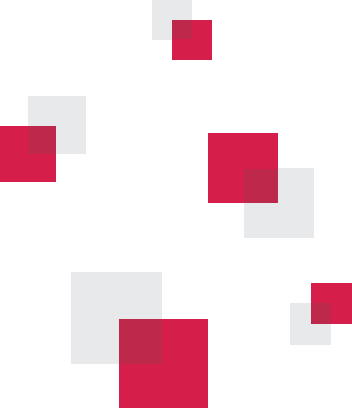Verwirrung, Vergessen und Demenz gehören zum Menschsein – genauso wie Altern und Leiden. Mit dieser These wandte sich Prof. Dr. Reimer Gronemeyer an die über 1000 Teilnehmenden des Kongresses. Demenz ist nicht nur ein medizinisch-pflegerisches Problem – es ist ein Problem der Gesellschaft, betonte er. Aus seiner Sicht ist es wichtig, Demenz nicht auf eine Krankheit zu reduzieren, sondern als Auftrag zu mitmenschlich-sozialem Handeln zu verstehen. Dies setzt jedoch voraus, dass wir bereit sind, Demenz als etwas anzunehmen, das zum menschlichen Leben gehört. Erst wenn dies gelingt, werden Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen nicht mehr gesellschaftlich isoliert sein. Umso mehr braucht es Menschen, welche die leistungsorientierte, «kalte» Gesellschaft «wieder erwärmen», so Reimer Gronemeyers Appell. Pflegende und betreuende Angehörige tragen bereits vorbildhaft zu einer «wärmenden Gesellschaft» bei. «Die Frage nach der Demenz ist die Frage nach der demenzfreundlichen Gesellschaft» − diese Schlüsselaussage Reimer Gronemeyers zog sich wie ein Leitmotiv durch den gesamten Kongresstag. 17 Referentinnen und Referenten führten vor Augen, welche Rahmenbedingungen es braucht, damit «Selbstmanagement» aus der Perspektive der Betroffenen, der Angehörigen und der Pflegenden gelingen kann.
Demenz zur gesellschaftlichen Priorität machen Etwa 119 000 Menschen in der Schweiz sind an Demenz erkrankt. 28 000 neu diagnostizierte Personen kommen jährlich hinzu. 36 000 Angehörige sind von der Demenzerkrankung eines Familienmitglieds betroffen. Etwa 300 000 Menschen widmen sich beruflich der Versorgung von Personen mit Demenz. Birgitta Martensson, Geschäftsleiterin der Schweizerischen Alzheimervereinigung, verdeutlichte die gesellschaftliche Herausforderung, die sich hinter diesen Zahlen verbirgt.
Die Hälfte der Menschen mit Demenz lebt zu Hause − dank der Unterstützung durch Angehörige. Schreitet die Krankheit fort, sind pflegende Angehörige häufig rund um die Uhr gefordert. Umso wichtiger ist es, sie vor Überlastung und Erschöpfung zu schützen. Drei Elemente sind hierfür wichtig: Wissen, Verstehen und Handeln. Wissen Angehörige, welche Veränderungen Demenz mit sich bringt, können sie ihre Lebenssituation besser einschätzen und vorausschauend handeln. Doch auch die gesamte Gesellschaft sollte über Demenz Bescheid wissen. Menschen mit Demenz sind Mitmenschen. Deshalb ist es unverzichtbar, dass alle wissen, worauf sie in der Begegnung mit Betroffenen achten sollten und wie sie persönlich zu einer demenzfreundlichen Gesellschaft beitragen können.
Demenz bedroht Beziehungen «Er ist wie eine leere Hülle − ausgepumpt und leer» − so erlebt eine Frau ihren Partner, der an Demenz erkrankt ist. Am Schmerzhaftesten für Nahestehende ist oft nicht der Verlust geistiger Fähigkeiten, sondern die emotionale Unerreichbarkeit eines Menschen mit Demenz. Diesen Beziehungsaspekt der Erkrankung erläuterte Dr. med. Irene Bopp-Kisler, Oberärztin der Universitären Klinik für Akutgeriatrie im Zürcher Stadtspital Waid. Die Person mit Demenz ist zwar sichtbar und spürbar «da», aber «doch so fern». Diese erschreckende «Ferne» kann Beziehungen und Partnerschaften dramatisch gefährden. Betroffene und Angehörige erfahren tiefe Kränkungen, weil sie einander nicht mehr «verstehen» können. Um der drohenden Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung entgegenzuwirken, können Fachpersonen Wege aufzeigen, wie trotz dieser Fremdheit ein Leben in gegenseitiger Achtung möglich ist. Dazu gehört, Familien behutsam vorzubereiten auf das ständige «Abschiednehmen» von Gewohntem und Vertrautem. «Es wird niemals wieder so sein, wie es einmal war» − dieser Gedanke löst immense Trauer aus. Jedoch können Abschiedsrituale hilfreich sein, um gemeinsam etwas zu beenden, was in Zukunft nicht mehr möglich sein wird. Wichtig ist auch, mit Angehörigen über Themen zu sprechen, für die sie häufig keine Worte finden: Scham, Sexualität, Empathieverlust und Schuld. Erlebtes, Empfundenes und Gedachtes zur Sprache zu bringen, kann eine hilfreiche Form des «Selbstmanagements» sein. Umso anspruchsvoller ist es für Fachpersonen, wenn Menschen mit Demenz die Sprache fehlt und sie sagen: «Können Sie mir helfen? Ich bin so stumm».
Betroffenen eine Stimme geben Wie geht eine Gesellschaft mit besonders verletzlichen Personen um? Diese Frage stellte Prof. Dr. Hermann Brandenburg, Philosophisch-Theologische Hochschule Vallendar, ins Zentrum. Er wies darauf hin, dass sich die öffentliche Wahrnehmung häufig ausschliesslich auf die erschreckenden und belastenden Aspekte der Demenz konzentriert. Wäre es nicht wichtig, eine «Entschreckung» der Demenz zu erreichen? Dies erscheint besonders dringend, da sich die Versorgungsstrukturen oft eher an den Bedürfnisse der Angehörigen oder der Trägerschaft ausrichten – und weniger an den Anliegen und Wünschen der Personen mit Demenz. Somit wäre es notwendig, in Zukunft den Blick stärker auf die Betroffenen zu richten. Diese wünschen sich, am Leben der Gesellschaft weiterhin teilnehmen zu können, sich aktiv durch sinnvolle Tätigkeiten einzubringen und selbstbestimmt leben zu dürfen. Bedeutsam wäre es auch, die verbliebenen Fähigkeiten und Stärken von Menschen mit Demenz mehr als bisher zu beachten. Zugleich braucht es die Einsicht, dass Demenz, Gebrechlichkeit und Altern nicht menschenunwürdig sind und keine «minderwertige» Daseinsweise darstellen, so Hermann Brandenburg. Ein solches Umdenken könnte wesentlich zur «Entschreckung» der Demenz im gesellschaftlichen Bewusstsein führen.
Ein Leben «auf der Suche nach mir selbst» «Ich habe mich sozusagen selbst verloren» − mit diesen Worten beschrieb im Jahr 1901 Auguste Deter, die erste Alzheimer-Patientin, ihr Erleben der Demenz. Der Verlust des eigenen Selbst ist eine bestürzende Erfahrung. Dafür zu sorgen, dass dieser Verlust nicht unerträglich ist, macht einen bedeutsamen Teil der Betreuung von Menschen mit Demenz aus, so Prof. Dr. Thomas Beer, Fachhochschule St.Gallen. Er erläuterte, wie eng das «Selbstmanagement» von Menschen mit Demenz mit dem Bestreben verbunden ist, das verlorene Selbst, die frühere Selbstständigkeit und Autonomie zurückzugewinnen. Wie die Forschung beschreibt, sind gerade im Frühstadium fünf Interventionen wichtig, um das «Selbstmanagement» der Betroffenen zu stärken: das familiäre Netzwerk stärken, einen aktiven Lebensstil aufrechterhalten, psychisches Wohlbefinden fördern, das Bewältigen kognitiver Veränderung unterstützen und über das Krankheitsbild Demenz informieren.
Zwischen Fürsorge und Selbstsorge Nur eine Persönlichkeit, die fest in sich selbst ruht, kann Menschen hilfreich begegnen, die unablässig «auf der Suche nach sich selbst» sind. Ohne achtsame Selbstsorge ist keine Fürsorge möglich. Doch wer Menschen mit Demenz pflegt, sollte auch den Rückhalt der Organisation und des Teams erleben dürfen. Darauf wies Petra-Alexandra Buhl aus der Sicht der Organisationsentwicklung hin. Um zu verhindern, dass Pflegende in ihrer Arbeit mit Betroffenen die Grenzen ihrer Belastbarkeit überschreiten, stehen auch Arbeitgeber in der Pflicht. Hier setzt das Konzept der «organisationalen Resilienz» an. Die Organisation übernimmt vorausschauend Verantwortung für Mitarbeitende und schult sie mit Hinblick auf mögliche Krisensituationen. Eine resiliente Institution ermöglicht Pflegenden mehr Selbstorganisation und stärkt gezielt die Ressourcen der Teams. So lässt sich sicherstellen, dass Pflegende nicht allein auf ihre Selbstsorge angewiesen sind, sondern auch Sorge vonseiten ihrer Organisation und ihres Teams erfahren.
Kann Technik entlasten? Um Pflegende in der Betreuung von Menschen mit Demenz zu entlasten, können auch technische Innovationen einen Beitrag leisten. Wie Heidrun Gattinger, Fachhochschule St.Gallen, berichtete, können Mobility-Monitore mittels eines Sensors unter der Matratze ohne jeglichen Körperkontakt feinste Bewegungen messen. Bleiben Eigenbewegungen im Rahmen von drei Stunden aus, erfolgt automatisch eine Immobilitätswarnung an die Pflegenden. Dadurch können sie Umlagerungen gezielter durchführen, und das Dekubitusrisiko lässt sich vermindern. Um Stürzen vorzubeugen, bietet der Mobility-Monitor auch einen Bettkanten- oder Ausstiegsalarm. Bevor sturzgefährdete Bewohnende aufstehen, können Pflegende bereits im Zimmer anwesend sein.
Das Mobility-Monitor-System dient auch als Assessment-Instrument und ermöglicht, Pflegemassnahmen bedürfnisorientiert zu planen. Eine Untersuchung in drei Schweizer Pflegeheimen mit 150 Pflegepersonen und 52 Bewohnenden ergab, dass der Einsatz des Mobility-Monitors kombiniert mit Schulungen zum Thema Demenz und Fallbesprechungen in mehrfacher Hinsicht entlasten kann: Der Lagerungsbedarf lässt sich besser erfassen und zeitlich optimierte Pflegemassnahmen sind möglich. Pflegende können anhand der Monitordaten das Bewegungsmuster bzw. die nächtliche Aktivität von Bewohnenden erkennen. Diese Daten dienen Pflegenden auch als Grundlage für Gespräche mit dem ärztlichen Dienst und den Angehörigen. Fallbesprechungen mit und ohne Monitor-Daten verringerten die erlebte Hilflosigkeit der Pflegenden.
Auch den Bewohnenden kann diese technische Innovation zugutekommen: Unnötige nächtliche Umlagerungen oder Störungen lassen sich vermeiden, was für eine bessere Schlafqualität sorgt.
Viventis-Preis für das beste Praxisprojekt
Erstmals vergaben die Fachstelle Demenz der FHS St.Gallen und die Viventis-Stiftung einen mit 10 000 Franken dotierten Preis für das beste Praxisprojekt in der Pflege und Begleitung von Menschen mit Demenz in der Schweiz. Preisträgerin ist die Genossenschaft für Altersbetreuung und Pflege Gäu (GAG) in Egerkingen (Kanton Solothurn). Im Alterszentrum Stapfenmatt hat sie das Projekt «Höchstmass an Normalität in der Alltagsgestaltung von Menschen mit Demenz» verwirklicht. Bewohnende können dadurch ihren vertrauten Lebensstil beibehalten. Da die Wohngruppen ländlich-bäuerlich, häuslich, handwerklich oder im gehobenen Stil eingerichtet sind, können sich Menschen mit Demenz im Alterszentrum fast wie zu Hause fühlen. Auch die Betreuungsformen und Gruppenaktivitäten entsprechen der gewohnten Lebensart. Mit diesem innovativen Projekt findet die Idee des Demenzdorfes De Hogewey auch in der Schweiz Einzug. Erste Erfahrungen zeigten, dass Bewohnerinnen und Bewohner im Alterszentrum Stapfenmatt seltener Unruhe zeigten, weniger Medikamente benötigten, mobiler waren und seltener stürzten. Ein vielversprechender Ansatz, der Mut macht, kreative Wege zu gehen.
Hinweis
Der 4. St. Galler Demenz-Kongress findet am 16.11.2016 in den Olma Messen St.Gallen statt: www.demenzkongress.ch