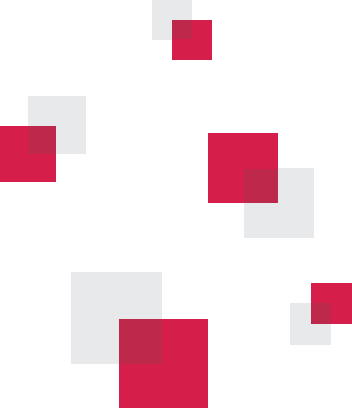Individualbesteuerung erhöht Erwerbsanreize für Zweitverdiener
Der Bundesrat schlägt eine zivilstandsneutrale Individualbesteuerung vor. Diese wirkt sich positiv auf die Beschäftigung aus – vor allem bei Frauen.
Wie soll die Familienpolitik im Jahr 2040 ausgestaltet sein, um den Bedürfnissen der verschiedenen Familienkonfigurationen gerecht zu werden? In Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen Kommission für Familienfragen (EKFF) veröffentlicht die «Soziale Sicherheit» (CHSS) eine Reihe von Beiträgen aus Wissenschaft und Forschung, die sich mit den künftigen Herausforderungen der schweizerischen Familienpolitik befassen.

Der Bundesrat schlägt eine zivilstandsneutrale Individualbesteuerung vor. Diese wirkt sich positiv auf die Beschäftigung aus – vor allem bei Frauen.
Mit dem Nobelpreis von Claudia Goldin anerkennt auch die Mainstream-Ökonomie die Bedeutung der Forschung zu Geschlechtergerechtigkeit. Eine wichtige Rolle spielen kulturelle Normen, wie ein neues Buch der US-Wirtschaftsjournalistin Josie Cox zeigt.
Viele Familien in der Schweiz können sich Erwerbs- und Familienarbeit nicht so aufteilen, wie sie es gerne möchten. Dies hat unter anderem mit Wertvorstellungen zu tun.
In einem egalitären Betreuungsmodell teilen sich Eltern Care- und Erwerbsarbeit auf. Das Verankern dieses Standards auf allen Staatsebenen trägt dazu bei, schweizweit familienpolitische Ziele zu erreichen.
Familienentscheidungen unterliegen starken äusseren Zwängen – bei der Aufteilung von unbezahlter Sorgearbeit und Erwerbsarbeit sind die Wahlmöglichkeiten begrenzt. Einen Ausweg aus diesem Dilemma bietet ein reform-orientiertes familienpolitisches Kompromissmodell.
Die Schweizerische Familienpolitik ist seit den 1990er-Jahren ein zunehmend bedeutungsvolleres Politikfeld, das mobilisiert und polarisiert. Auf Grund der grösser werdenden Verflechtungen drängt sich unter anderem eine Diskussion über die föderalistische Kompetenzordnung auf.